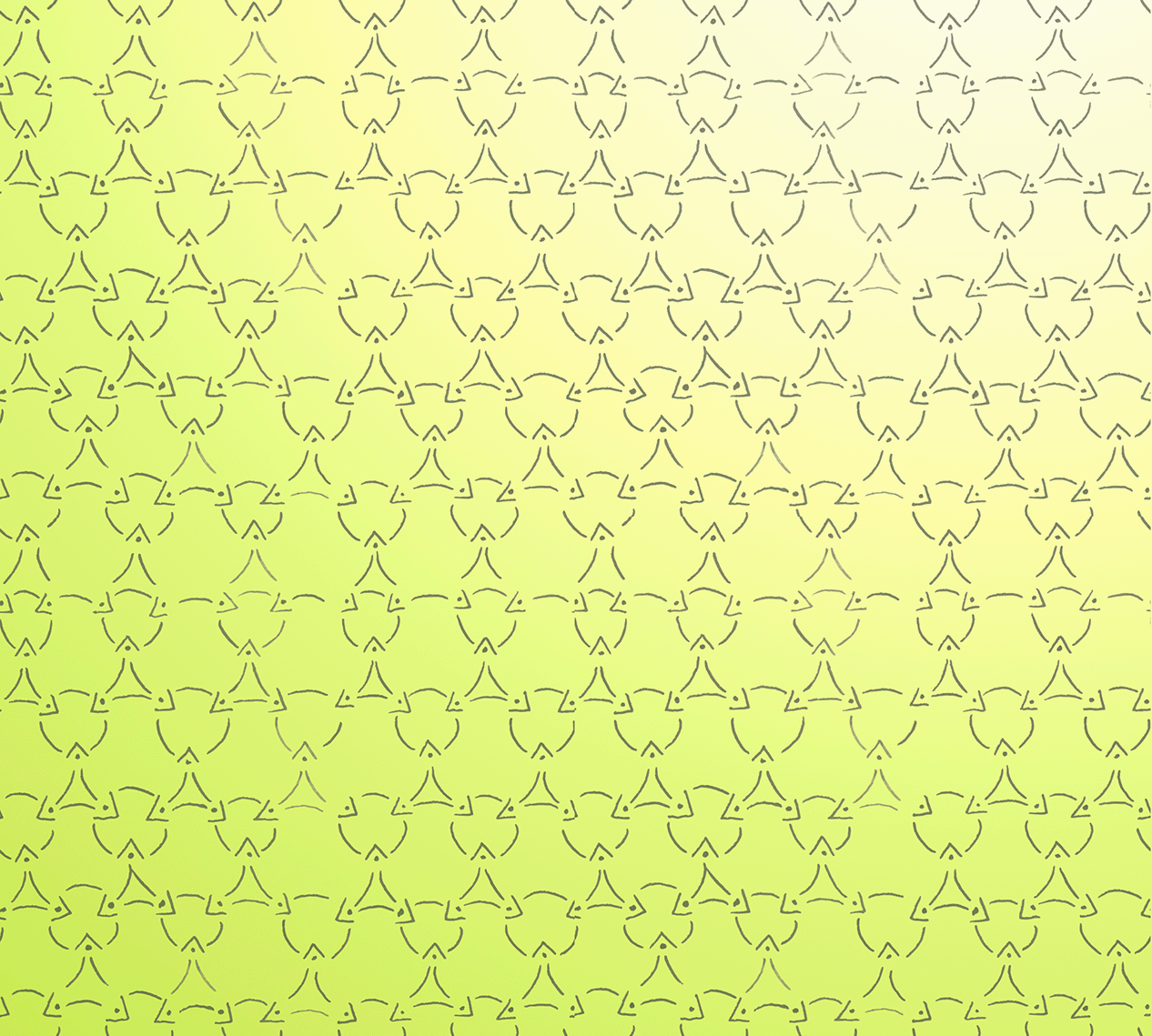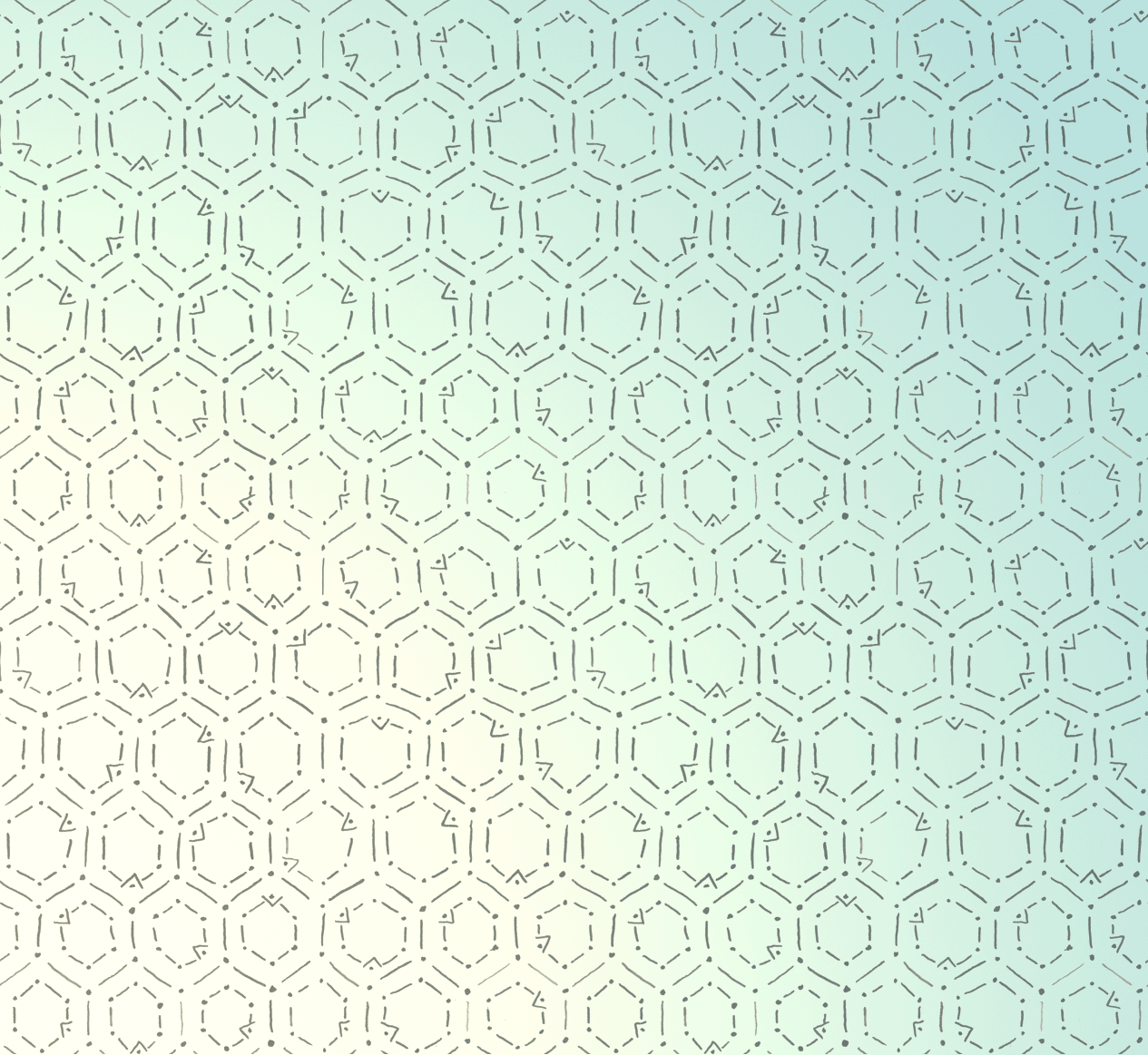Mehr Workshop als Podiumsdiskussion
„Ich hatte befürchtet, es wird so ein typisches Streitgespräch: wir im Publikum gegen die auf dem Podium. Aber das war ja mehr wie ein Workshop!“
Bereits zum zweiten Mal durfte ich am Montag ein Bürgergespräch zum Thema „Medienvertrauen in Sachsen“ moderieren.
Anlässlich einer qualitativen Studie des Zentrums für Journalismus und Demokratie der Uni Leipzig, die das Medien- und Politikvertrauen in Sachsen untersucht hat, veranstaltet die Friedrich-Ebert-Stiftung Bürgergespräche in den sächsischen Landkreisen.
Das Besondere daran: Wer eine Expertendiskussion erwartet, in der nicht mehr als 5 Publikumsfragen Platz haben, wird enttäuscht. Und wer nur schweigend zuhören will, wird ebenfalls überrascht. Denn gemeinsam mit CivixX – Werkstatt für Zivilgesellschaft haben wir die Bürgergespräche so konzipiert, dass alle zu Wort kommen können – und auch ein bisschen sollen.
Warum keine klassische Podiumsdiskussion?
Wer kennt das nicht: Meist dominieren bei emotional aufgeladenen Themen die lautesten Stimmen – diejenigen, die keine Scheu vor dem Mikrofon und dem Sprechen vor 40 Menschen haben. Oft entsteht eine eher konfrontative Situation – wir, das Publikum, gegen die da oben auf dem Podium, und jetzt geigen wir denen mal richtig unsere Meinung!
Es ist wichtig, Räume für Kritik zu öffnen. Doch eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema, den genannten Perspektiven und der eigenen Position – wie in einem guten Gespräch eben – findet so oft nicht statt. Meist sind es Wenige, die viel Raum einnehmen, und Viele, die man nicht hört. Ein konstruktiver Austausch sieht anders aus.
Unser etwas anderer Ansatz
Mit den Bürgergesprächen versuchen wir, das aufzubrechen: Wir laden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, sich in kleinen Gruppen zunächst untereinander auszutauschen – und auch gemeinsam Fragen aufzuschreiben, die sie an die Gäste aus dem Journalismus haben. Diese Fragen strukturieren dann das Gespräch zwischen Moderation und Medienschaffenden auf dem Podium. Anschließend wird die Runde für direkte Rückfragen geöffnet. So können noch Einzelne aus dem Publikum zu Wort kommen.
Dieser Ansatz ist gerade im Kontext von sinkendem Medienvertrauen und wachsender Polarisierung hilfreich: Wir öffnen einen Raum, in dem Teilnehmende selbst ins Gespräch kommen und viele Blickwinkel sichtbar werden können. So wandelt sich das Format von „Streitforum“ zu einem gemeinsamen Projekt: Alle sind gefordert, zuzuhören, nachzufragen und neu zu gewichten. Am Ende steht ein differenzierteres Bild statt des einen siegreichen Arguments.
Erfahrungen und Rückmeldungen
Die erste Veranstaltung dieser Art fand in Bautzen statt, die zweite nun in meiner Heimatstadt Hoyerswerda in Kooperation mit der VHS. Sie unterschied sich sehr im Hinblick auf die Dynamik im Raum und die Themen, die eingebracht wurden. Sicher lag das auch an der Gruppengröße (15 statt 40 Teilnehmer*innen).
Besonders gefreut haben mich die bisherigen Rückmeldungen: Einige wenige Teilnehmer*innen hätten sich mehr Raum gewünscht für ihren direkten Kontakt mit den Podiumsgästen. Doch die meisten haben uns ihre Zufriedenheit mit dem Ansatz gespiegelt.
Manche hatten im Vorfeld eine konfrontative Stimmung befürchtet und waren dankbar, dass es anders kam. Andere schätzten das Gespräch mit Menschen, mit denen sie zu diesem Thema vermutlich selbst keinen Austausch gesucht hätten. Und einige zogen die Verbindung zur demokratischen Kultur: Dass es genau diese Art des Zuhörens und Aushandelns braucht – im kleinen, alltäglichen Miteinander ebenso wie in der breiten Öffentlichkeit, wo Medienschaffende in der Verantwortung sind, die Debatten der Gesellschaft abzubilden.